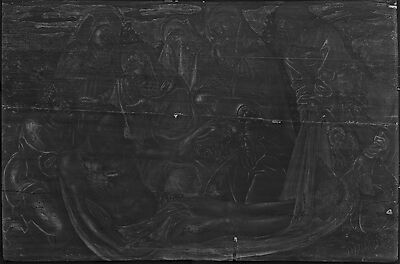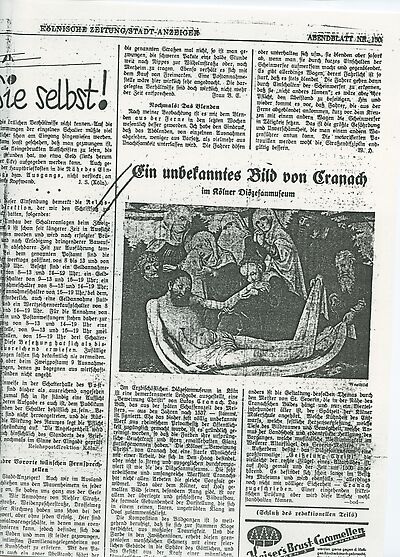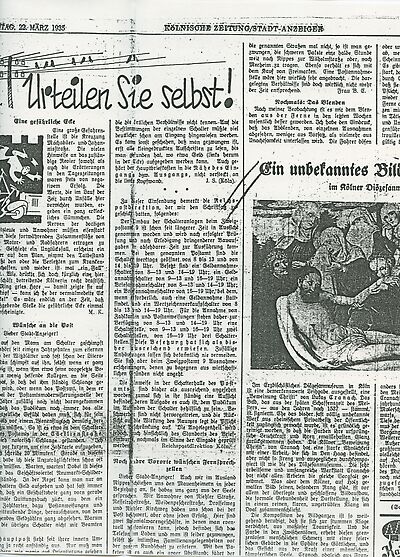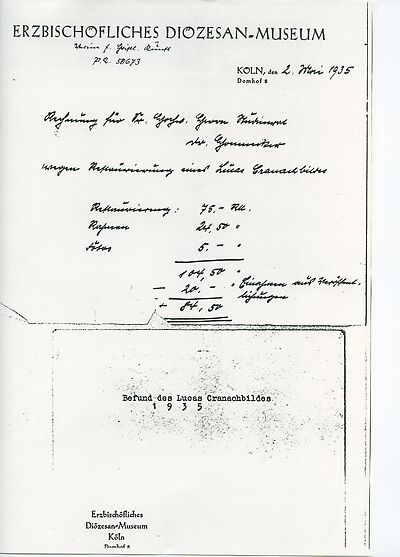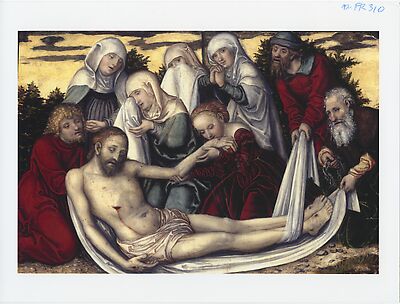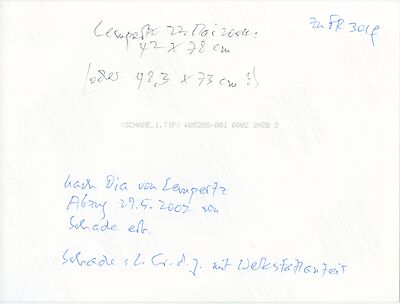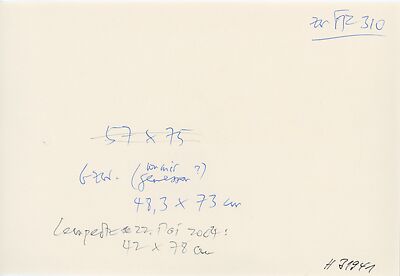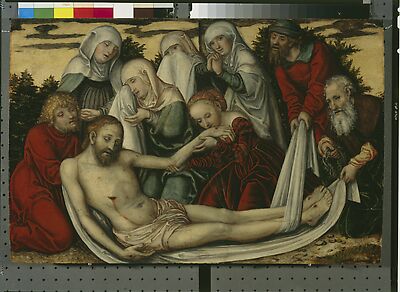- Zuschreibungen
-
Lucas Cranach der Ältere und Werkstatt
Lucas Cranach der Ältere
Zuschreibungen
| Lucas Cranach der Ältere und Werkstatt | |
| Lucas Cranach der Ältere | oder der Jüngere [Lempertz online database: https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/856-1/1033-lucas-cranach-d-ae.html; accessed 26-03-2019] (nicht mehr verfügbar) |
| Lucas Cranach der Jüngere | oder der Ältere? laut Koepplin 'eher' der Jüngere |
- Datierungen
- um 1540
um 1550
Datierungen
| um 1540 | [Heydenreich, Blumenroth, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 31.03.2023] |
| nach 1537 | [cda 2019] |
| um 1550 | [Lempertz online database: https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/856-1/1033-lucas-cranach-d-ae.html; accessed 26-03-2019] (nicht mehr online, 22.11.2021) |
- Maße
- Maße Bildträger: 42 x 78 cm
Maße
Maße Bildträger: 42 x 78 cm
[Lempertz online database: https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/856-1/1033-lucas-cranach-d-ae.html; accessed 26-03-2019] (nicht mehr verfügbar online, 22.11.2021)
- Signatur / Datierung
Oben rechts bezeichnet: Schlangensignet mit liegenden Flügeln
Signatur / Datierung
Oben rechts bezeichnet: Schlangensignet mit liegenden Flügeln
- Inschriften und Beschriftungen
Auf der Rückseite: - Aufkleber mit Aufschrift: „SALE No 10389“
- mit Kreide: „4“
[Heydenreich, Blumenroth, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 31.03.2023]
- mit Kreide: „4“
Inschriften und Beschriftungen
Inschriften, Wappen:
Auf der Rückseite:
- Aufkleber mit Aufschrift: „SALE No 10389“
- mit Kreide: „4“
[Heydenreich, Blumenroth, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 31.03.2023]
- Eigentümer
- Privatbesitz
- Besitzer
- Privatbesitz
- CDA ID
- PRIVATE_NONE-P271
- FR (1978) Nr.
- FR-none
- Permalink
- https://lucascranach.org/de/PRIVATE_NONE-P271/